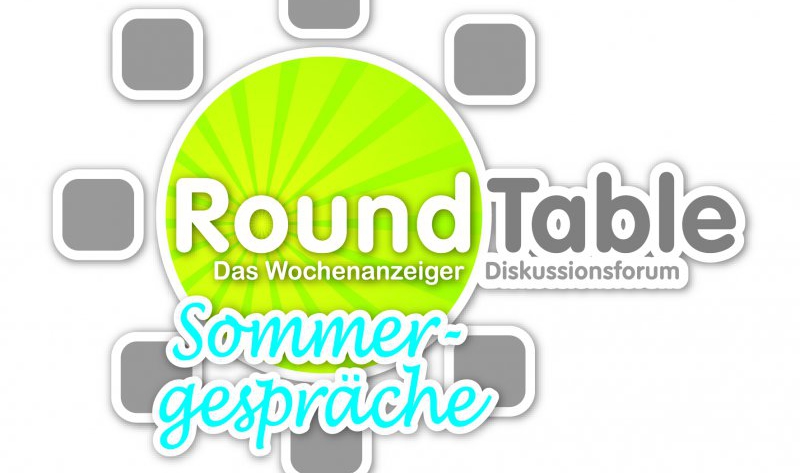"Wir halten den Ganztag ganz klar für den besten Weg, aber diktieren ihn nicht"
Was ist gut fürs Kind? Stadtschulrat Rainer Schweppe über Kinderbetreuung, Ganztagsschule und Schulausbauoffensive
 Hier klicken für weitere Bilder
Hier klicken für weitere Bilder
Rainer Schweppe: "Wir entwickeln Ganztag auf sehr hohem Niveau. Daran arbeiten wir mit Nachdruck." (Foto: job)
"Ganztagsbetreuung" ist in aller Munde, ganz gleich welche Altersgruppen und Schularten angesprochen werden. Schon Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern wünschen sich eine qualitativ hochwertige Betreuung oft über den ganzen Tag. In Grundschulen und weiterführenden Schulen steigt die Nachfrage nach Ganztagsangeboten enorm, in München machen sie ungefähr 40 Prozent der Elternwünsche für den gebundenen Ganztag im Primarbereich aus. Welche unterschiedlichen Erwartungen und Herangehensweisen haben die Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher? Ulrike Seiffert sprach darüber mit dem Münchner Stadtschulrat Rainer Schweppe.
"Die Grundlage liegt völlig quer"
Rainer Schweppe: Die Grundlagen für das heutige Schulsystem in Deutschland wurden mit der vierklassigen Grundschule und der Etablierung der Jugendhilfe im frühen 20. Jahrhundert gelegt. Schule ist Landessache aufgrund der Kulturhoheit der Länder. Jegliche Betreuung der Kinder übernahmen die Jugendhilfe-Träger wie kirchliche Träger, Wohlfahrtsverbände und sonstige Träger – zum Beispiel auf der Basis eines Bundesgesetzes.
Historisch gesehen haben wir somit eine sehr klare Trennung zwischen vor- und nachmittags, die auch heute noch prägend ist und die man sich verdeutlichen sollte, wenn man Bildung in Deutschland einordnen will. In den 80/90er-Jahren wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) auf Bundesebene mit der Begrifflichkeit des ganzheitlichen Bildungsanspruchs in das Sozialgesetzbuch aufgenommen. Dies ist nun neben den Landesschulgesetzen (SG) grundlegend. Die Schule an sich verantworten nach wie vor aber die Länder.
Bildung in Deutschland beinhaltete historisch somit also vormittags die Schule und nachmittags etwas anderes. Die Professionen und Qualifikationen, die Kompetenzen, die Ansätze und Ziele werden einerseits auf der Schulebene und andererseits auf der Jugendhilfeebene definiert. Die Mauern sind systematisch hoch, ein angemessener Austausch findet auf Bundes- und Landesebene nicht immer statt. Und man redet meines Erachtens nicht ausreichend über gemeinsames Ziele. Dabei handelt es sich doch vormittags wie nachmittags um dieselben Kinder! Das ist leider die Grundlage, die in Deutschland völlig quer zum Ganztagsbildungsanspruch liegt.
Betreuungsbedarf steigt und steigt
Hat sich dies mit der Einführung eines Konzepts für die Ganztagsschule geändert?
Rainer Schweppe: Das Konzept geht auf das Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB) 2003 zurück. Große Investitionen flossen in den Schulbereich. Das gewachsene System von Schule und Jugendhilfe kam in Bewegung. Mehr noch: Jugendhilfe u nd Schule setzten und setzen sich mit ihrer Identität auseinander.
Die eigentliche Frage ist doch: „Was ist das Beste für die Kinder?“
In Bayern und speziell in München muss natürlich ebenfalls mit dieser Situation umgegangen werden. Auch hier gibt es die gesetzlicheTrennung zwischen Soziales und Schule. Bisher blieb vieles Organisatorische, aber auch pädagogisch Konzeptionelle unverändert.
Nun wächst der Bedarf nach einer pädagogisch durchdachten Ganztagsbetreuung in Bayern auch enorm, in großen Städten wie München ganz besonders. 86 % der Münchner Grundschuleltern möchten ihre Kinder über die Schule hinaus betreut wissen. Im klassischen Sinn schätzen sie die Halbtagsschule mit den verschiedenen Angeboten am Nachmittag.
Doch es gibt auch den gebundenen Ganztag, wo sozusagen alles aus einem Bildungshut, einem pädagogischen Konzept, kommt und der Tag entsprechend der Bedürfnisse der Kinder strukturiert wird . Lerneinheiten, Entspannung, kreative und sportliche Aktivitäten wechseln sich hier ab. Aber dies können wir in München für höchstens zehn Prozent der Grundschüler bieten. 40 Prozent der Eltern würden solch eine Möglichkeit gern nutzen. Die Entwicklungen sind sehr gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Doch können wir noch längst nicht sagen: "Leute, ihr habt eine Auswahl!" In München kooperieren Jugendhilfe und Schulen seit Jahren erfreulicherweise eng miteinander.
"Ganztag ist nicht verdoppelter Schulstress"
Beleuchten wir die pädagogischen und organisatorischen Inhalte. Ist jedes Kind in der Ganztagsschule gut aufgehoben? Was geben Familien an die Schule ab? Und wie sieht beispielsweise die Vereinbarkeit von Schule und Hobbys aus?
Rainer Schweppe: Ganztagsschule findet größtenteils bis maximal 16 Uhr statt, dann sind die Schüler draußen und haben Zeit für alles andere. Im gebundenen Ganztag des Primarbereichs ist darüber hinaus auch Zeit zum Spielen eingeplant. Und man darf nicht vergessen: Hausaufgaben müssen nicht anfallen, sie können bis 16 Uhr erledigt sein!
Eine Botschaft ist mir ganz wichtig: Gute Ganztagsschule ist nicht verdoppelter Schulstress! Sie ist keine einfache Verlängerung der Schule in den Nachmittag hinein. Sie bedeutet vielmehr eine Entlastung und mehr individuelle Förderung der Kinder. Es ist doch leider so, bereits ab der Grundschule mehr als 30 Prozent der Kinder mit Kopfschmerzen und ähnlichem kämpfen. Der Druck ist enorm, wir sprechen nicht zufällig vom "Grundschulabitur" in der vierten Klasse. Eine gute Ganztagsschule nimmt sich Zeit für jedes Kind, baut Druck ab, fördert es in seiner Einzigartigkeit. Das Prinzip ist einfach: Wenn ich mich entspannen kann und Abwechslung habe, lerne ich besser.
Werden Eltern ausgegrenzt?
Wie bekommen die Eltern mit, wie es ihren Kindern geht, wenn diese den ganzen Tag in der Schule sind?
Rainer Schweppe: Indem alle Beteiligten miteinander arbeiten! Wir geben zum Beispiel den Schulkindern dafür ein kleines Werkzeug mit: das Münchner Logbuch, eine Art Lerntagebuch. Dort werden die wöchentlichen Lernziele, die Kommentare der Lehrer zum Unterricht und den Entwicklungsschritten festgehalten. Und darin findet sich Platz für die Kommentare der Eltern. Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern muss stimmen. Dies ist ein wichtiges Ziel!
"140 neue Lehrerstellen"
Marode Schulhäuser, schlecht ausgestattete Schulen, wenig Lehrer und viele Stundenausfälle vor allem in den oberen Klassen sprechen eine andere Sprache. Hier tun sich Lücken auf, vor denen eine noch so gute Ganztagsschule kapitulieren muss.
Rainer Schweppe: Generell gilt: Die Gebäude und Ausstattungen sind Sache der Kommune, die Lehrer Sache des Freistaats, eine Nachmittagsbetreuung Sache der Träger. In München kommen städtische Schulen mit städtischen Lehrern hinzu. Grund- und Mittelschulen sowie staatliche Gymnasien und Realschulen gehören unter die Hoheit des Freistaates. Darauf haben wir als Stadt keinen Einfluss.
Die Stadt München stattet die städtischen Realschulen und Gymnasien mit Ganztag besser aus als der Freistaat dies tut. 2013 hat der Stadtrat rechnerisch rund 140 neue Lehrerstellen für Gymnasien und Realschulen beschlossen, damit bis zum Jahr 2018 u.a. über 60 Prozent der städtischen Realschulen im gebundenen Ganztag arbeiten können. Wir entwickeln Ganztag auf hohem, angemessenem Niveau.
"Das gibt uns Luft"
Zwei "Beschleunigungswerkzeuge" haben wir zur Verbesserung der Raumsituation entwickelt. Nummer eins: die Schulentwicklungspläne. Sie vereinen Schulbedarfe, Größen, Standorte und demografische Analyse. Die Erkenntnisse daraus verarbeiten wir in einer neuen Arbeitsform, nämlich in referatsübergreifenden Arbeitsgruppen.
Nummer zwei: die Bauprogrammbeschlüsse des Stadtrats zur Schulbauoffensive, d ie sozusagen Sammelbeschlüsse und nicht aufwändige Einzelbeschlüsse sind . In 2015 haben wir 14 Standorte mit Schulpavillons versorgt. In 2016 kommen weitere 28 Anlagen hinzu. Das gibt uns Luft, um fast 50 notwendige Schulneubauten und ausstehende Generalsanierungen im zweistelligen Bereich zu stemmen.
Bislang wurde der Raumbedarf für jede neue Schule einzeln definiert. Das hat viel Zeit gekostet. Nun hat der Stadtrat ein Standardraumprogramm verabschiedet und wir wissen relativ schnell, welche Schulgröße auf welches Grundstück mit welchen Raumkapazitäten gebaut werden kann. Ganz neu ist übrigens auch ein zusätzlicher Bauunterhaltsetat von 35 Millionen Euro, den Schulen unmittelbar zur Verfügung haben. Diesen Handlungsspielraum hat es vorher nicht gegeben.
"Der beste Weg"
Inwieweit werden Ganztagsüberlegungen in der Schulausbauoffensive berücksichtigt?
Rainer Schweppe: Unsere Standardraumstruktur umfasst grundsätzlich Inklusion und Ganztag. Die Schulen werden nach dem Lernhauskonzept gebaut. Für das Beispiel Grundschule heißt das: Zwischen zwei Unterrichtsräumen befindet sich immer ein Differenzierungsraum, und es gibt Team-Räume zur Verbesserung der Arbeitssituation der Pädagoginnen und Pädagogen . Auch Altbestände werden nach diesem Prinzip saniert. Die Schulfamilie kann in der vorgegebenen Raumstruktur entwickeln, was sie für richtig hält und welche Form der Nachmittagsbetreuung vonstatten gehen soll. Wir halten den Ganztag ganz klar für den pädagogisch besten Weg, aber diktieren ihn nicht. Das ist mir sehr wichtig.
"Kaum Sitzenbleiber und Schulabbrecher"
Gebundener Ganztagsunterricht ist eine relativ junge Form der Beschulung. Welche Erfahrungen liegen bisher vor?
Rainer Schweppe: Einige Münchner Ganztagsschulen sind so gut geworden, dass sie kaum Schulabbrecher und Sitzenbleiber haben. Nehmen wir die städtische Anne-Frank-Realschule. Dort gibt es eine fast 100-prozentige Abschlussquote und quasi keine Sitzenbleiberinnen und Sitzenbleiber mehr. Für ihr hervorragendes Konzept hat die Schule sogar den Deutschen Schulpreis 2014 bekommen.
Qualitätskriterien für den Deutschen Schulpreis sind übrigens Leistung, Vielfalt, Unterrichtsqualität, Schulklima, außerschulische Partner und: Die Schule soll eine lernende Institution sein. Sie soll sich damit befassen, wie sie sich weiter entwickeln kann. Das ist doch genau das, was wir Eltern von Schule erwarten! In einer Halbtagsschule sind solche Sachen nicht so umfassend umsetzbar.
Für mich persönlich ist ein weiterer Aspekt der Ganztagsschule wichtig: die stabile Schulgemeinschaft! Von beispielsweise altersgemischten Gruppen profitiert jeder. Die Individualität wird gelebt und gefördert und gleichzeitig zieht ein Kind das andere mit. Mit dieser positiven Erfahrung starten die jungen Leute in die Zukunft.
"Da ist unglaublich viel passiert"
Welches Fazit würden Sie ziehen, wenn Sie auf Ihre Zeit als Stadtschulrat zurückblicken?
Rainer Schweppe: Ich freue mich über die hervorragende Entwicklung der Ganztagsschulen. Da ist unglaublich viel passiert. Auch im Kita- und Krippenbereich können wir auf große Erfolge schauen. Wir haben das größte Bauprogramm in der Geschichte Münchens in Milliardenhöhe etabliert. Das ist großartig und erfüllt mich mit Stolz. Auch auf der pädagogischen Ebene haben wir viel Anerkennung erfahren, nehmen wir nur den eben erwähnten Schulpreis für die Anne-Frank-Realschule.
Die Weichen sind in meinen Augen sehr, sehr gut gestellt. Unser Referat ist von 12.000 auf 14.000 Mitarbeiter angewachsen. Wir haben einen großen Organisationsprozess gestemmt, sind sehr gut mit anderen Referaten vernetzt. Wir alle gemeinsam haben in den vergangenen fünf Jahren eine großartige Arbeit geleistet. Das wird so weitergehen.
Das denken unsere Leser
Am Ganztagsunterricht scheiden sich die Geister. Unsere Leser haben sich mit vielen Beiträgen zu Wort gemeldet:
"So helfen wir unseren Kindern nicht!"
Diplompsychologe Samar Klaus Ertsey schreibt:
Ich arbeite seit 23 Jahren als Nachhilfelehrer und habe diese Tätigkeit seit meiner Schulzeit lückenlos ausgefüllt. Heute bin ich Diplompsychologe und betreibe nebenher noch eine ehrenamtliche Schule für junge, unterprivilegierte Künstler.
Es ist kein Geheimnis, dass das Schulsystem seit den neuesten Reformen an seinem qualitativen Tiefpunkt seit Gründung der BRD steht. Schüler lernen immer weniger Stoff in immer mehr Stunden und behalten davon immer weniger.
Sicherlich ist ein zu bedenkender Faktor, dass Kinder, die als "Schlüsselkinder" unbeaufsichtigt zuhause sind, ihre Hausaufgaben nicht erledigen, wodurch ihnen die Übung fehlt, um das Erlernte zu verfestigen.
Leistungen durchweg schlechter
Aber Ganztagsschulen sind keine Lösung. Ich habe Schüler unterrichtet - samstags - die Ganztagsschulen besuchten, und muss sagen, dass ihre Leistungen durchweg schlechter waren als die der Schüler, die mich stattdessen zweimal pro Woche besuchen konnten.
Jedes vierte Kind in Deutschland nehme Nachhilfe, heißt es. Das ist doch einmal der Faktor, den wir wirklich hervorheben sollten. Dass es soweit kommen konnte, ist doch das wahre Zeichen schulischen Bankrotts. Der Schulunterricht, den wir - als Eltern - in immer neuen Verschlimmbesserungen an unseren Schulen zulassen, versagt darin, unsere Kinder zu bilden. Gerade hat mir ein ehemaliger Schüler, der eine Realschule in München besucht hat, erklärt, dass er noch nie den Namen "Weiße Rose" in der Schule gehört habe. Wenn das nicht empörend ist, dann weiß ich es auch nicht.
"Länger" ist nicht gleich "besser"
Es gibt einen Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Kinder länger am Tag in Schulen zu schicken, die nichts taugen, kann die Situation nicht verbessern. Das ist ein ähnlich absurder Gedanke, als wolle man Eisen schmieden, indem man eine Wärmflasche darauf legt, und wenn es partout nicht glühen will, dann lässt man die Flasche eben länger darauf liegen!
Ich kenne die Hausaufgabenbetreuung in Ganztagsschulen nur zu gut. Den Schülern wird nicht beigestanden, Selbstrecherche im Internet ist unerwünscht, Schulbücher stehen nicht zur Verfügung, Sachverhalte werden von fachfremdem Aushilfspersonal sogar falsch erklärt. In einem meiner Fälle haben die Eltern reagiert und das Kind wieder unter der Woche zu mir geschickt, als eine Lehrkraft der Schule der Ärmsten erklärte, parallele Linien ziehe man nach Augenmaß, weil das "ja nicht so wichtig" sei, es sehe soweiso niemand hin. Die Folge war natürlich eine glatte Sechs in Mathematik gewesen.
Hilft bloße Anwesenheit?
Was soll die Ganztagsschule im Angesicht von Lehrermangel denn bitte positiv bewirken? Sind wir so naiv zu glauben, dass die bloße Anwesenheit einer Aufsicht Schülern beim Lernen hilft? Haben wir denn alles vergessen, was wir in der Schule unternommen haben, um die Aufsicht zu überlisten? Was soll der anwesende Aushilfslehrer tun, wenn er innerhalb von 45 Minuten 30 Fragen aus allen Fachbereichen gestellt bekommt?
Auch Freizeitgestaltung wird durch die Ganztagsschule zum Nervenkrieg geraten. Schon jetzt ächzen die Kinder doch unter all den Extra-Aktivitäten, von Tennis und Fußball über Tanz und Musik hin zur, ja, Nachhilfe. Wenn nun die kostbaren Stunden des Tage in der Schule verbracht werden müssen, wann sollen denn dann diese Dinge stattfinden? Alle samstags? Da kennen wir aber Sportvereine schlecht.
Und nicht zuletzt sind damit dann auch die Kapazitäten begrenzt und ganze Wirtschaftszweige gefährdet. Wenn alle Tanzschulen und alle Klavierlehrer nur noch samstags und sonntags Schüler haben, dann werden diese Studios allesamt vom finanziellen Ruin bedroht.
"Ganztagsschulen dienen niemand"
Ganztagsschulen dienen niemand. Sie kosten Staat, Stadt oder Eltern mehr Geld, vermitteln kein Deut mehr Wissen und setzen die Kinder noch mehr unter Druck und Beobachtung.
Wer würde profitieren? Nur diejenigen, die sich und andere belügen. Da wären zu nennen: Selbsternannte Pädagogen, die ohne wissenschaftliche Basis behaupten, dass Ganztagsschulen einen positiven Effekt haben werden, nur weil sie ganztags stattfinden. Aber dieser Zusammenhang steht ursächlich gar nicht fest. Es gibt bessere und schlechtere Schulen. Es wäre gut denkbar, dass ein paar bessere Schulen nebenbei auch Ganztagsbetreuung anbieten, ohne dass der Effekt sich umdrehen lässt.
Und natürlich die Eltern, die sich einreden lassen, sie seien bessere Eltern, wenn sie ihr Kind der Schule anvertrauen. Aber Schule hat weder den Anspruch noch das Recht, unsere Kinder zu erziehen. Wenn der Wert der Bildung nicht zuhause vermittelt wird, ist Anwesenheit in der Schule für die Kinder reines Eingesperrtsein, "Schulknast", der sie jder Freiheit und Selbstverantwortung beraubt. So helfen wir unseren Kindern nicht!
Das "Bildungsgehumpel" reformieren!
Es muss eine ordentliche Schulreform her, die wissenschaftlich begründet ist und sich den besonderen Herausforderungen unserer neuen Zeit anpasst, nicht immer wieder nachträgliches Herumgeschraube an einem System, das in seinem Kern in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand und so einfach nicht mehr zeitgemäß sein kann.
Deutschland hat sich verändert. Die Schule hinkt immer nur hinterher. Und unsere Kinder diesem Bildungsgehumpel noch länger auszusetzen, ist kontraproduktiv.
Ganztagsschule ohne ein entsprechendes Mehr an Personal und einer angemessenen Didaktik ist der beste Weg, jedes Interesse an Bildung in den jüngeren Generationen endgültig zu ersticken.
"Klar im Nachteil"
Christine Schönenberger schreibt:
Ich war über 30 Jahre Erzieherin und bin Mutter von zwei erwachsenen Kinder. Ich arbeitete Teilzeit in einer Einrichtung mit Kindergarten und Hort. Zur Zeit engagiere ich mich aushilfsweise in einer Hausaufgabenbetreuung,die von Kolping geführt wird. Meine jahrelange Beobachtung in den Einrichtungen brachten mich zur Erkenntnis - und das wurde mir auch von meinen Kollegen bestätigt - dass ein großer Teil der Hort- und Mittagsbetreungskinder im Vergleich zur häuslichen Betreuung klar im Nachteil sind. Viele Kinder tun sich schwer, durch die notwendige Eigendisziplin sich zu auf ihre Arbeit zu konzentieren. Sie lassen sich leicht ablenken und sind darauf bedacht, entweder möglichst schnell und dadurch oft schlampig ihre Hausaufgabe zu erledigen, oder kommen durch langes Hinauszögern aus unterschiedlichen Gründen nicht voran. Leider kommt es auch zu oft wechselndem Personal, dem es dann kaum möglich ist, die Kinder kontinuierlich in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Mir ist natürlich klar, dass diese Umstände sich verbessern würde, wenn genügend geschultes Personal vorhanden wäre. Viele Kinder könnten einen höreren Schulabschluss erreichen, wenn sie bessere Rahmenbedingungen hätten. Solange die jetzige Betreuungssituation so ist und sich in der nächsten Zeit nichst ändern wird, sind Kinder, die von ihren Eltern betreut werden, klar im Vorteil.
Familien fehlt Zeit zusammen
Was mich an Ganztagsschulen stört, dass die Kinder nicht die Möglichkeit haben, ihren Nachmittag nach ihren Wünschen, Neiungen (z.B. vielfältige Vereine) und Bedürfnisse zu gestalten und die Eltern ihre Kinder nur für wenige Stunden am Abend erleben und dann selber kaum Zeit für sie haben. Manche Eltern sollten sich Gedanken machen, was ihnen wichtiger ist: Geld oder ihre Kinder. Mein Mann und ich schränkten uns in dieser Lebensphase ziemlich ein und haben es nie bereut, in diesem schönen Zeitabschnitt viel mit unseren Kindern zu erleben und sie begleiten zu dürfen.
Alle einbeziehen
Wolfgang Schwirz meint:
Ja, es muss ein Ganztagesangebot an Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium geben, denn viele Eltern sind darauf angewiesen. Und der Bedarf wird weiter steigen. Doch ist der längere Aufenthalt in der Schule nur dann sinnvoll, wenn die Nachmittagsbetreuung oder - besser gesagt - Nachmittagsgestaltung pädagogisch sinnvoll und vielfältig ist. Das heißt: Hausaufgaben machen kann nur ein Teil davon sein, darüber hinaus muss es ein weitgefächertes Angebot an Freizeit-, Sport-, Fitness-, Lese-, Spiel- und Ruheangeboten geben.
Das kann aber nicht den ganzen Nachmittag in der Schule geschehen. Sportvereine, Musikschulen, Bibliotheken und Freizeitstätten sind einzubeziehen und - ganz wichtig - es muss den Kindern auch Freiraum, sprich Zeit, gegeben werden für eigene und unbeaufsichtigte Aktivitäten. Auch Eltern sollten einbezogen sein bei der Nachmittagsbetreuung, sei es, dass sie z. B. an einem Tag in der Woche vor Ort dabei sind (wenn sie können), sei es, dass sie in Abstimmung mit den Lehrern die Gestaltung der Nachmittage mit planen und besprechen.
Die nötigen Mittel bereitstellen
Und schließlich: die Ganztagesbetreuung können nicht die Lehrer alleine packen und gestalten, da müssen Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen mitwirken von Sozialpädagogen über Sporttrainer und Bibliothekare bis zu Musikern, um nur diese zu nennen. Die Schulen selbst müssen ebenfalls den veränderten Bedingungen angepasst werden, brauchen also nicht nur Unterrichtsräume sondern auch Freizeit-, Sport- und Ruheräume. Hier gibt es in München schon entsprechende Planungen und Konzepte bei Schulneubauten, was zu begrüßen ist, doch auch die bestehenden Schulen müssen berücksichtigt werden. Das kostet natürlich viel Geld, das momentan aber leider nur zögerlich bereitgestellt wird. Auch das muss sich zukünftig ändern, wobei ich alle Ebenen anspreche vom Bund über die Länder bis zu den Kommunen. Ein Streit darüber, wer für welche Maßnahme zuständig ist und diese zu bezahlen hat, hilft uns hier nicht weiter. Den jeweils Zuständigen und Handelnden (auch den Schulen selbst) müssen die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dann sind das gut angelegte Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger.
"Ich hatte schlechte Ausgangsbedingungen"
Jenny Blumenthal meint:
Mich irritieren die Leser, die sich gegen Ganztagsschulen äußern. Kennen sie solche Schulen, um beurteilen zu können, wie es dort ist? Ich war mehrere Jahre auf einer norddeutschen, ganztägigen Gesamtschule und habe dort ein gutes Abitur absolviert. Wäre ich im bayerischen Schulsystem groß geworden, würde ich heute ganz sicher nicht als Universitätsabsolventin mit 35 Jahren in leitender Funktion arbeiten.
Ich hatte denkbar schlechte Ausgangsbedingungen: achtjähriges Scheidungskind, Mädchen, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die alleine für den Unterhalt in einem Vollzeitjob sorgen musste. Ich besuchte den Kindergarten bis zum Nachmittag und in der Schule war ich Hortkind. Dort habe ich die Hausaufgaben erledigt, und zwar unter Anleitung eines Lehrers, der das auch streng kontrolliert hat! Vorher habe ich mit meinen Mitschülern, quasi in einer Lerngruppe, die richtigen Lösungen überlegt und unverstandenen Stoff besprochen.
"Meine Mutter konnte mir nicht helfen"
Meine Mutter konnte mir bei den Hausaufgaben oft gar nicht helfen, auch wenn sie es gerne gewollt hätte und natürliche hätte ich mir ihre Unterstützung gewünscht. Eine zwanghafte, häusliche Nachmittagsbetreuung, wie sie hier einige Lesern fordern, hätte mir nur geschadet und mich niemals an die Universität gebracht. In der 6. Klasse meinten die Lehrer, ich hätte nicht das Zeug für das Gymnasium, geschweige denn für das Abitur. Auch Lehrer können sich irren! Ich blieb bis zur 10. Klasse an der Schule und wechselte danach an eine ganztägige Gesamtschule, an der ich ein gutes Voll-Abitur in der 13. Klasse absolvierte.
An dieser Ganztagsschule nutzte ich nachmittags die Bibliothek und den Hausaufgabenraum, die beide von Lehrern betreut wurden. Dort habe ich gemeinsam mit Mitschülern die Hausaufgaben erledigt und von deren Wissen und der Hilfe der Lehrer profitiert. Ich wollte das Abitur selbst, weil ich im Bekanntenkreis gesehen habe, welche Möglichkeiten es mir eröffnen kann. Diese innere Motivation können Eltern niemals von außen bei ihren Kindern erzeugen, mit keiner Spezialbetreuung oder noch so guten Schule!
Ich habe durch meine Schulausbildung folgendes gelernt: Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und -organisation und den nötigen Biss, wenn es anstrengend wird. Diese Eigenschaften braucht man im Universitätsstudium und ganz sicher im Berufsleben. Desto früher man das lernt, umso besser. Ich habe an der Uni einige Leute aus bildungsnahen Schichtern scheitern sehen, die sicher schlau waren, denen aber oben genannte Fähigkeiten beim Studienbeginn fehlten.
Sinnvoll - wenn gut organisiert
Fazit: Ganztagsschulen sind sehr sinnvoll, wenn sie gut organisiert sind. Die alleinige häusliche Nachmittagsbetreuung sehe ich kritisch, weil Eltern das zeitlich und intellektuell (!) ständig leisten können müssen. Selbst wenn das funktioniert, fehlt womöglich der Ausstausch und die Auseinandersetzung mit Mitstreitern, welche man spätestens im Studium und im Beruf zwingend braucht. Ich bin davon überzeugt, dass Ganztagsschulen, so wie ich sie besucht habe, Bayern gut täten, weil mehr Kinder aus einfachen Verhältnissen die Chance auf eine höhere Schulbildung hätten.
"Ach, du arbeitest nicht?!"
Margarete Sedlmeyer schreibt:
Ihre Leserbriefe "Klar im Nachteil" und "Ganztagsschulen sind keine Lösung" zeigten klar, dass sich die Forderung nach Ganztagsschule nicht an den Kindern selbst orientiert, sondern an politischen und wirtschaftlichen Kriterien.
Im Klartext: kleinere Klassen, pädagogisch besser geschultes Personal, mehr Unterrichtsstunden fürs Üben z.B. in Mathematik - das kostet; so wie ja auch die steuerlich noch wesentlich besser zu begünstigenden Familien (so dass nicht beide Elternteile in der Erziehungsphase berufstätig sein müssen) ...
Aber auch unser sog. Wertekanon ist zu hinterfragen: "Ach, du arbeitest nicht?!" Warum muss man sich solche Geringschätzung gefallen lassen von Müttern der Mitschüler? Weil Hausarbeit und Kinderbetreuung daheim nicht die gleiche Arbeitsleistung darstellen wie die entsprechende Tätigkeit in bezahlten Jobs?
Hut ab vor einigen meiner Bekannten, die in der DDR mit all den hier nun gepriesenen Segnungen zwecks Bildungsfortschritt aufwuchsen - und nun eisern Hausaufgabenbetreuung bei ihren eigenen Kinder daheim machen, nach selbstgekochtem Mittagessen und Spielpause. Die Durchlässigkeit im Bildungsbereich bietet heutzutage auch sog. "Spätzündern" gute Aufstiegschancen. Wenn sie selber wollen!
Als "promoviertes Arbeiterkind" weiß ich ferner, dass dies ohne entsprechende häusliche Hilfe sicher nicht so einfach ist wie für Kinder der Upper Class (umgekehrt bestätigt nun die Altersforschung die positiven Auswirkungen, wenn man sich den Anforderungen des Lebens gestellt hat).
Entwickeln wir uns zum "Entwicklungsland"?
Ja, und in meinem Entwicklungshilfe-Einsatz in Südamerika erlebte ich in vielen Bereichen die hohe Wertschätzung des dualen Bildungssystems in Deutschland. Warum waren bis ca. 1995 deutsche Fachleute dort gefragt? Weil nicht alle Länder die handwerkliche = praktische Ausbildung mit schulischer Begleitung anbieten! Unsere Kinder sollten wissen, dass im letzten Jahrhundert ein Universitätsabschluss nicht das absolute Bildungsziel in Deutschland war! Ich lernte damals, dass dort für einen guten Azubi-Platz zu zahlen war; dass die Übersetzung "universidad" = "Universität" hinterfragt werden musste (manche Hauptstadt dort hatte bis zu 20 solcher "Unis"). Das Hochschuldiplom in der Tasche versprach einen sog. "Krawattenposten" (un puesto de corbata). So weit ich von Freunden weiß, galt dies auch für viele Länder Afrikas und Asiens - mit den Händen zu arbeiten, wurde geringer eingeschätzt. Entwickeln wir uns zu einem "Entwicklungsland"?
Das Thema ist zu komplex, um einfach schwarz-weiß beurteilt zu werden. Und da es die Zukunft unserer Kinder entscheidet, sollten die Gründe für derlei "Schulreformen" ehrlich auf den Tisch gelegt werden.
Copyright: Wochenanzeiger Medien GmbH